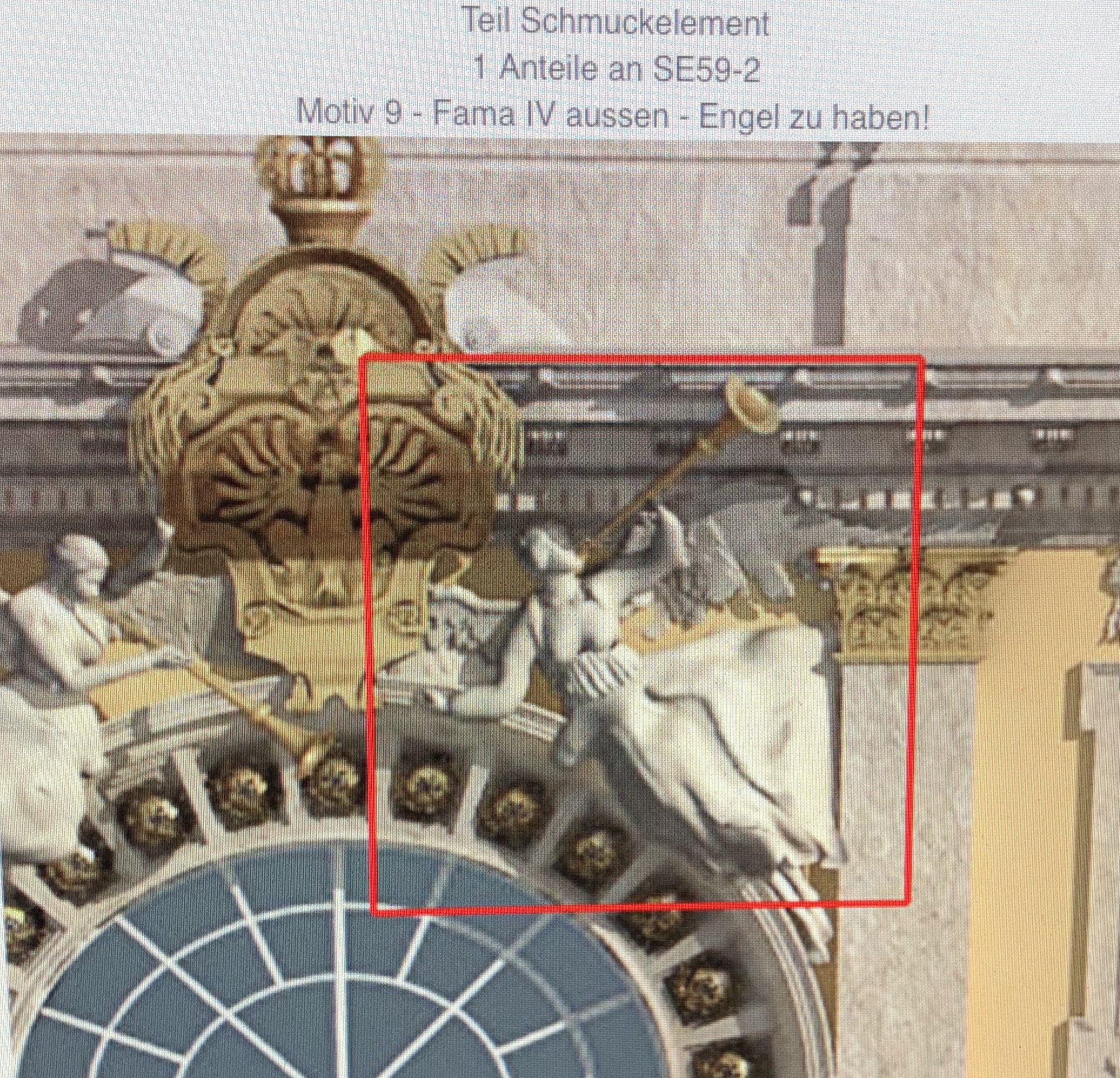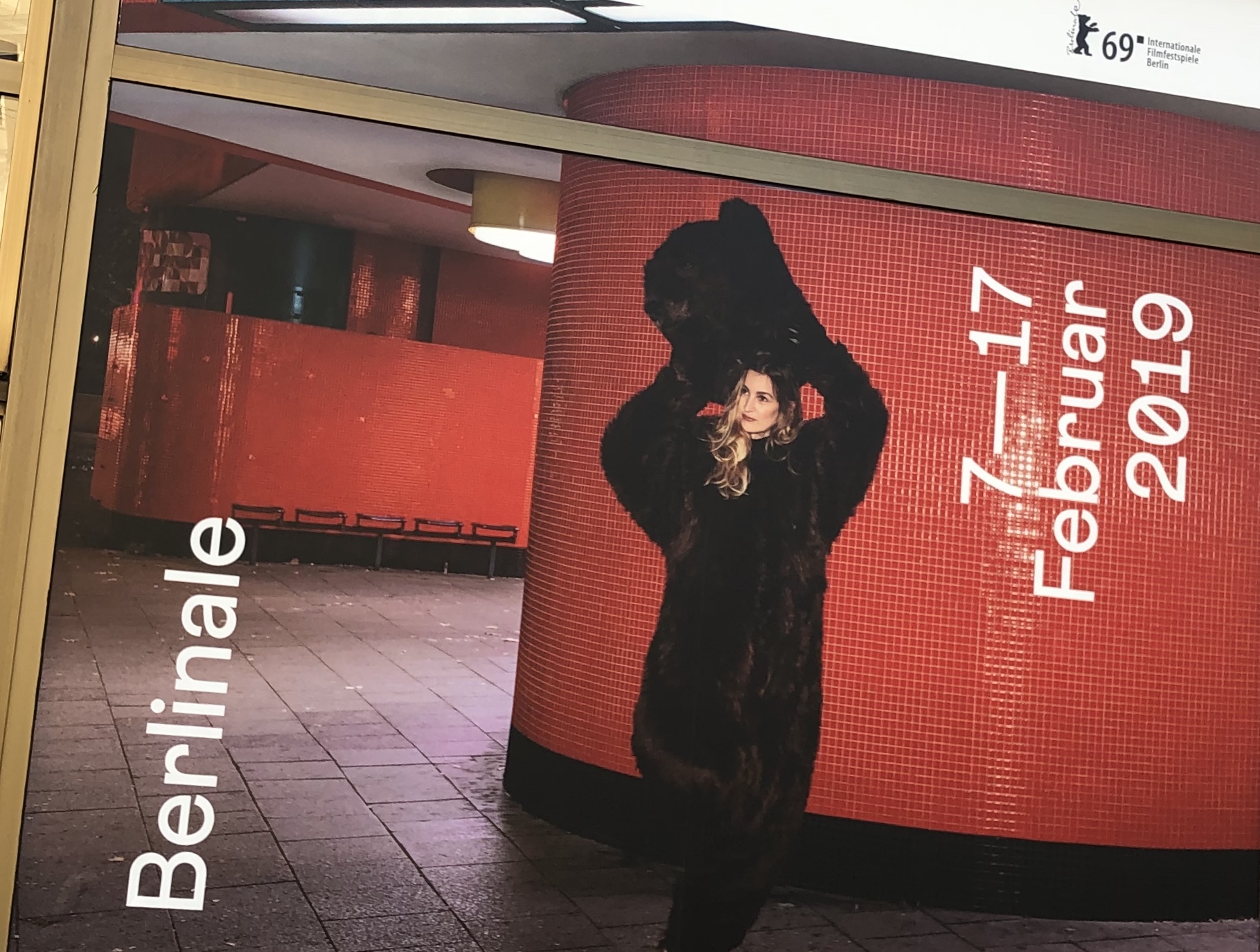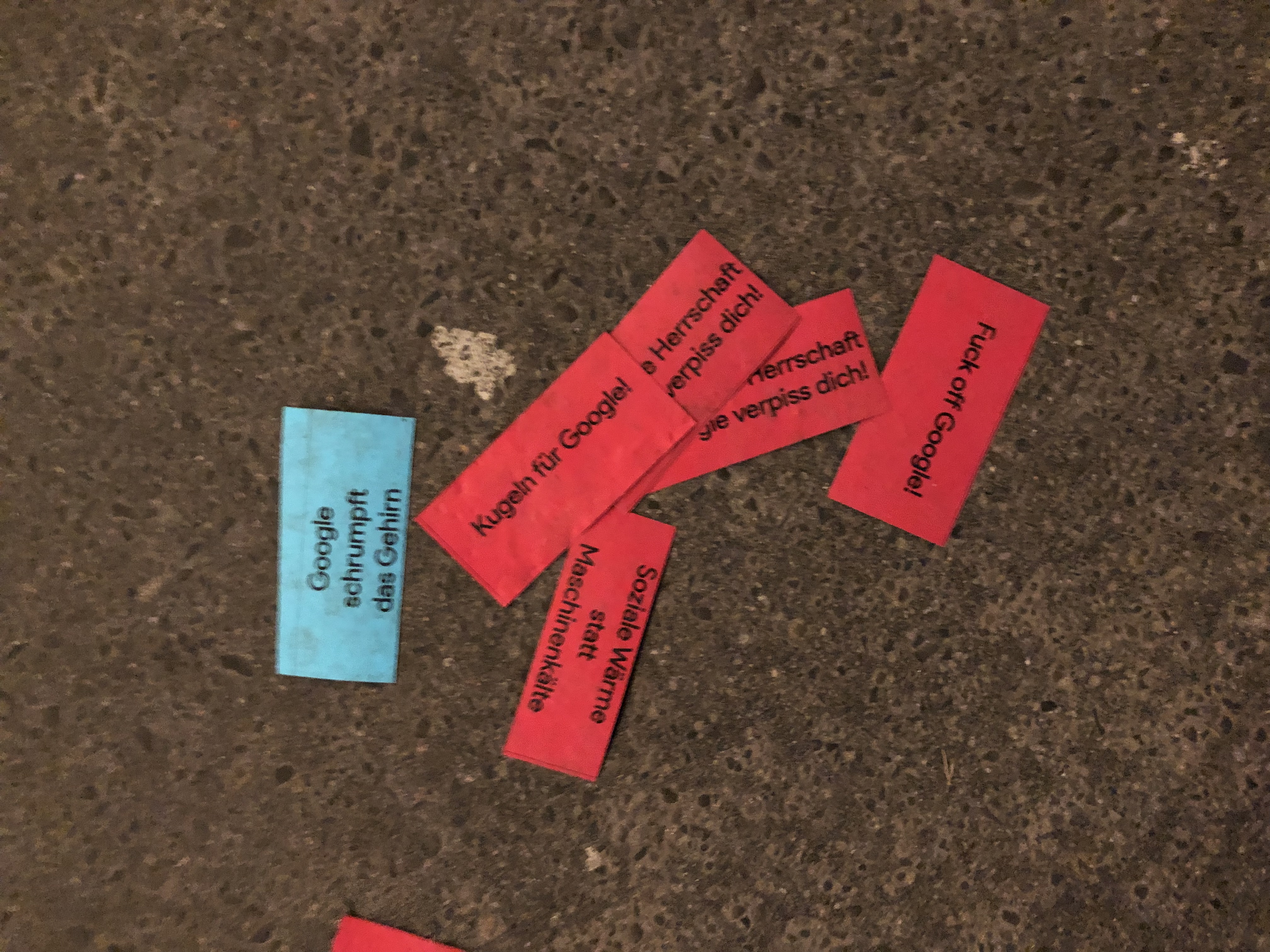Wird der Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union wirksam, ohne dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Austrittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des Vertrages über die Europäische Union in Kraft getreten ist, so kann die Bundesanstalt zum Schutz der Versicherungsnehmer und der Begünstigten von Versicherungsleistungen anordnen, dass die §§ 61 bis 66 und 169 für einen Übergangszeitraum für die Zwecke der Abwicklung der bis zum Austritt abgeschlossenen Versicherungsverträge auf Versicherungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, die zum Zeitpunkt des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union nach § 61 Absatz 1 Satz 1 und § 169 Absatz 1 Satz 1 über eine Niederlassung oder im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs im Inland tätig waren, entsprechend anzuwenden sind.
(Aus der Bundestagsdrucksache 19/7337 – Entwurf eines Gesetzes über steuerliche und weitere Begleitregelungen zum Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union – oder kurz: Brexit-Steuerbegleitgesetz = Brexit-StBG)